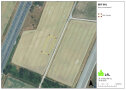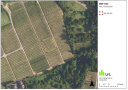Bodenmonitoring: 40 Jahre Boden-Dauerbeobachtung in Bayern
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Stechzylinder-Probenahme
Etablierung der Boden-Dauerbeobachtung in Bayern in den 1980er Jahren
In den 1980er Jahren wurde das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen einer zunehmend industrialisierten Gesellschaft auf die Bodenfruchtbarkeit geschärft. Meldungen über das "Waldsterben" durch sauren Regen und die Schwermetallbelastung der Umwelt durch Abgase aus verbleitem Benzin führten zu einem Umdenken.
Entwicklung seit den 1980er Jahren
Ziele und Aufgaben der Boden-Dauerbeobachtung
- Es gibt in Bayern mit ca. 90 Standorten eine hohe Anzahl an Acker-BDF mit guter Repräsentativität für Bayern
- Bis zum Jahr 2025 wurden auf den BDF-Standorten acht Wiederholungen der Bodenprobenahmen (etwa alle fünf Jahre) durchgeführt, so dass eine hohe Anzahl von Wiederholungsproben vorliegt
- Das BDF-Programm ist das einzige Monitoring in Deutschland, das Fakten und Kennwerte zu langfristigen Veränderungen generiert. Die BDF-Daten sind somit die einzige Grundlage für langfristige Zeitreihen im Bereich Boden und dienen als „Warnsystem“ für Veränderungen
- Die Erhebungen finden auf betriebsüblich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen statt und sind somit eine gute Ergänzung zu exakten Feldversuchen
- Im BDF-Programm wird der Bodenzustand neutral und ohne Erwartungshaltung beobachtet und der aktuelle Bodenzustand transparent und objektiv bewertet.
- Rückstellproben sind vorhanden, neue Parameter können somit rückwirkend untersucht werden.
- Die Daten werden dem Bund und anderen Forschungseinrichtungen anonym zur Verfügung gestellt und generieren somit einen hohen Mehrwert über das eigentliche BDF-Programm hinaus.
- Das BDF-Programm verliert immer wieder langjährige Beprobungsflächen aufgrund konkurrierender Nutzungen. Ursachen hierfür sind Überbauungen, die Nutzung als Ausgleichsflächen, der Flächenbedarf für Photovoltaikanlagen und Stromtrassen sowie der Sand- und Kiesabbau. Damit verringert sich die Anzahl der über die Jahre auswertbaren BDF und gefährdet die Fortführung von langfristigen Zeitreihen.
- Die Grünlandflächen im BDF-Programm sind mit einer relativ geringen Anzahl von etwa 20 Standorten vertreten, die sich hauptsächlich im Alpenvorland befinden. Diese Flächen repräsentieren vor allem das kühlere, feuchtere Grünland in Bayern.
- Der Umfang der Parameter muss kontinuierlich an neue Fragestellungen angepasst werden, da sich Umweltbelastungen im Laufe der Jahrzehnte verändern. Während in den 1980er Jahren beispielsweise die Bleibelastung durch verbleites Benzin und bestimmte Pflanzenschutzmittelgruppen im Vordergrund standen, rücken heute Stoffgruppen wie PFAS und Mikroplastik in den Fokus.
- Auch methodische Herausforderungen, die durch die Störung der BDF-Parzelle während der Probenahme entstehen, stellen eine zunehmende Herausforderung dar.
Im Fokus
Bund-Länder Treffen der Fachgruppen "Boden-Dauerbeobachtung“ dieses Jahr in Freising
Am 20. und 21. Oktober findet das jährliche Treffen der verantwortlichen Institutionen für die Boden-Dauerbeobachtung in Deutschland statt. Der Austausch unter Expertinnen und Experten, der jährlich von einem anderen Bundesland ausgerichtet wird, wird diesmal von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising organisiert. Im Fokus stehen aktuelle Themen wie die Aufnahme neuer Schadstoffgruppen, insbesondere PFAS, ins BDF-Programm sowie die Entwicklung gemeinsamer Projekte.
LfL-BDF erstmals auf PFAS und TFA beprobt

Nmin-Bohrer-Set
PFAS sind langlebige und umweltpersistente Chemikalien, die aufgrund ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Industrie- und Konsumprodukten eingesetzt werden und mittlerweile weltweit verbreitet sind. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat deshalb begonnen, PFAS auf ausgewählten Bodendauerbeobachtungsflächen systematisch zu messen, wobei die Probenahme besonders sorgfältig und nach Empfehlungen des Umweltbundesamtes erfolgt. Neben den wichtigsten PFAS werden auch zahlreiche Vorläufer- und Ersatzstoffe sowie Trifluoressigsäure (TFA) untersucht, da diese Stoffe ebenfalls persistent sowie mobil sind und künftig als relevant eingestuft werden könnten. Erste Ergebnisse der Messungen werden Ende 2025/Anfang 2026 erwartet. PFAS sollen dauerhaft ins bayerische Bodenmonitoring aufgenommen werden, auch im Hinblick auf kommende EU-Regelungen. Mehr
Verbreitung der Regenwurmarten in Bayern
Schnellansprache zur Regenwurmhäufigkeit im Acker

Regenwürmer sind wichtige Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und Zeiger für einen biologisch aktiven Boden. Die wissenschaftliche Standarderfassung der Regenwurmanzahl im Boden ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Für Äcker wurde daher auf den Boden-Dauerbeobachtungsflächen untersucht, wie gut eine einfache Schnellansprache die Häufigkeit der Regenwürmer im Boden wiedergeben kann. Mehr
Ergebnisse aus 35 Jahren Boden-Dauerbeobachtung

Am 18. Kulturlandschaftstag des Instituts für Agrarökologie und Biologischen Landbau wurden die Ergebnisse aus 35 Jahren Boden-Dauerbeobachtung in der Landwirtschaft in Bayern vorgestellt. Themenschwerpunkte der Tagung waren Entwicklungen im Bereich Humus, Bodenschadstoffe, Vegetation und dem Regenwurmbestand und mögliche Zusammenhänge zu Bewirtschaftungs-, Standort- und Klimaparametern. Mehr
Weitere Informationen zu den Fachbereichen
Boden
Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bodenwasserhaushalt

Bodenerosion auf einer Ackerfläche nach Starkregen. Foto: Anton Weig
Eine gute Bodenstruktur ist entscheidend für einen langfristig erfolgreichen Pflanzenbau. Bodenschutz umfasst dabei wichtige Aspekte wie die Vermeidung von Verdichtungen, den Schutz vor Erosion und die Regulierung des Bodenwasserhaushalts. Mit dem nötigen Wissen über bodenschonende Bewirtschaftungsmethoden lassen sich wirksame Strategien zum Schutz des Bodens umsetzen. Mehr
Bodenschadstoffe

Bestimmung von Immissionen aus der Luft
Böden können durch verschiedene Einflüsse wie Abfälle, Luftverschmutzung und landwirtschaftliche Maßnahmen mit Schadstoffen belastet werden. Besonders Schwermetalle und organische Umweltchemikalien stellen dabei eine Gefahr für Pflanzen, Tiere und Menschen dar. Regelmäßige Bodenuntersuchungen sind wichtig, um Schadstoffgehalte zu erfassen und die Umwelt zu schützen. Mehr
Humus

Humus als wichtiger Faktor der Bodenfruchtbarkeit
Humus beeinflusst nahezu alle Bodeneigenschaften und ist entscheidend für Bodenfruchtbarkeit und Ertragssicherung. Er dient als Nährstoffquelle für Pflanzen und Bodenorganismen, verbessert die Bodenstruktur, speichert Wasser und schützt vor Erosion. Die Bestimmung von Humusgehalten in landwirtschaftlich genutzten Böden ist daher Grundlage für zahlreiche Forschungsprojekte an der LfL. Mehr
Bodenleben

Tiefgrabender Regenwurm
Bodenorganismen beeinflussen die Stoff- und Energiekreisläufe sowie die Struktureigenschaften in unseren Böden und fördern somit maßgeblich die Bodenfruchtbarkeit. Ein reichhaltiges Bodenleben weist auf einen gesunden, biologisch aktiven Boden hin. Mehr
Vegetation und Pflanzendiversität
Acker-Vegetation

Kamille und Rittersporn am Feldrand
In Bayern werden rund 65 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche als Ackerbaufläche genutzt, auf denen über 300 verschiedene Wildpflanzen-Arten, darunter mehr als 50 seltene und gefährdete Arten, wachsen. Daneben gibt es Arten, die in Ackerflächen dominante Bestände bilden und den Ertrag und die Qualität der Ackerkulturen beeinträchtigen können. Die Zusammensetzung dieser „Begleitflora“ hängt stark von den Bewirtschaftungsmethoden, der Fruchtfolge sowie dem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ab. Mehr
Publikationen
- 35 Jahre BDF Band 1: Methoden, Standorte, Bewirtschaftung
- 35 Jahre BDF Band 2: Bodenphysik
- 35 Jahre BDF Band 3: Bodenschadstoffe
- 35 Jahre BDF Band 4: Humus
- 35 Jahre BDF Band 5: Regenwürmer
- 35 Jahre BDF Band 6: Kurzfassung und Fazit
- LfL-Magazin 2021: Smart Farming – Bodenmonitoring als Generationenaufgabe
 697 KB
697 KB
- Bayern – 25 Jahre Bodendauerbeobachtung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Präsentation)
 1,4 MB
1,4 MB
- Den Boden fest im Blick – 25 Jahre Bodendauerbeobachtung in Bayern (Tagungsband)

Kontakt
Arbeitsbereich Bodenmonitoring
Koordination: Florian Ebertseder, Melanie Treisch
Tel.: 08161 8640-5071
E-Mail: boden@LfL.bayern.de